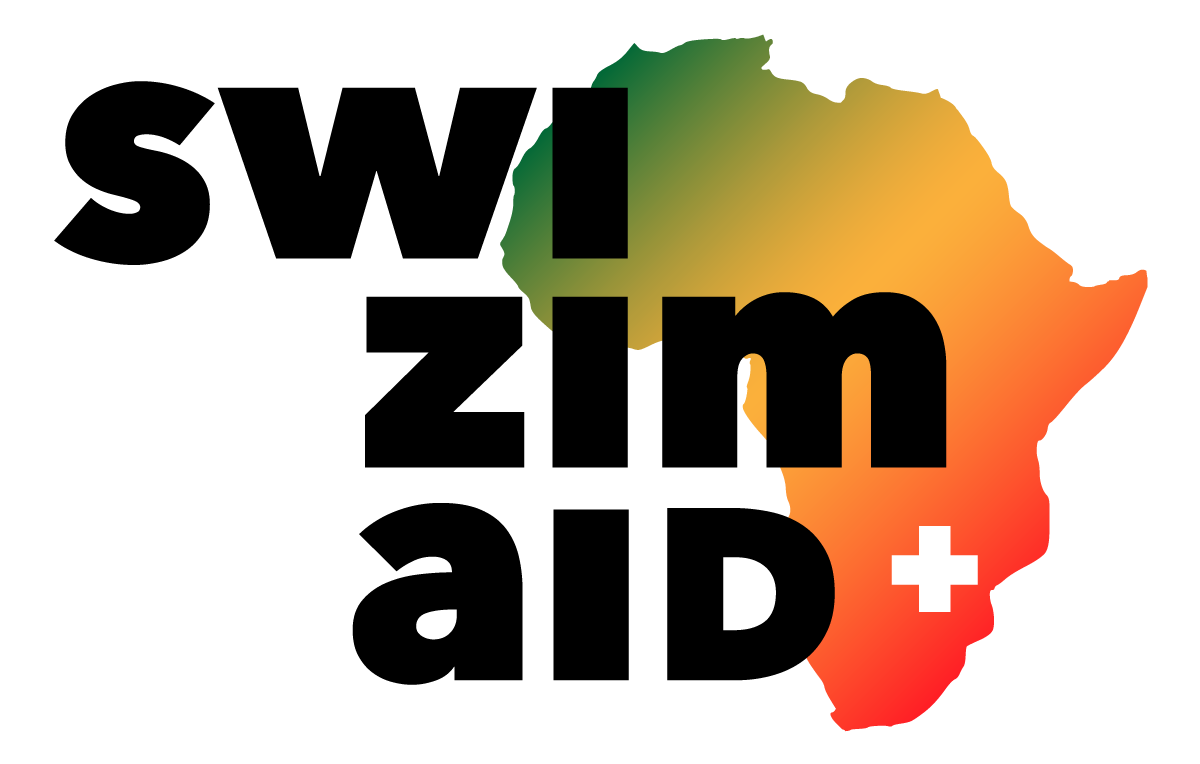Januar 2008: Geld und Geduld - Zimbabwes Armut und Reichtum zugleich

>>Newsletter als PDF herunterladen<<
Im Sommer 2007 wurden an verschiedenen Orten in der Schweiz «Kleider», Schuhe, medizinisches Material und anderes gesammelt, in einen Container verladen und auf die lange Reise nach Zimbabwe geschickt. Im November 2007 folgten Daniel Bates, Marc Bates, Christa Lässig, Thomas Kagoro (USA) und Samuel Büchi dem Container und kehrten anfangs Dezember übervoll von Eindrücken und Erlebnissen zurück. Zuviel, um einen lückenlosen Bericht schreiben zu können. Die nachfolgenden Erinnerungen sind daher lediglich Gedankenblitze, die immer nur einen kleinen Teil der Reise, des Landes, der Bevölkerung oder der Probleme von Zimbabwe beleuchten können.
Wo ist die Armut?
Mittwochnachmittag, der erste Tag. Nach einem problemlosen Flug von Zürich über London und Johannesburg landen wir in Harare auf einem makellos sauberen und modernen Flughafen. Wir werden abgeholt und per Auto in den Athol Evans Komplex, eine Residenz für ältere Menschen, gebracht. Auf den Strassen wimmelt es fast wie in einer europäischen Stadt von Autos, an den Strassenrändern halten sich unzählige Menschen auf, alle sauber und bunt gekleidet. In der Ferne erkenne ich Hochhäuser und andere moderne Bauten. Selbst das Hauptquartier der Heilsarmee ist eine gut unterhaltene und einladende Häusergruppe. Wo ist sie bloss, die Armut, wegen der wir ja eigentlich gekommen sind?
Lachen oder weinen?
Einer der ersten Menschen, mit denen wir in Zimbabwe sprechen, ist Major Gordon Howard, Engländer und Leiter des Athol Evans Komplexes. Ich höre von ihm nicht viel Gutes über Zimbabwe. Seine Schilderungen machen mir ein wenig Angst, seine Bitterkeit raubt mir fast die Vorfreude auf die kommenden Tage. Dennoch kann ich ihn verstehen. Zu viel hat er in den letzten Jahrzehnten erlebt. Zu gross ist seine Frustration über den schleichenden Untergang des einst so blühenden Landes. Zum Glück macht er uns am selben Auf einer ungewöhnlichen Reise in einem ungewöhnlichen Land: Christa Lässig, Thomas Kagoro, Samuel Büchi, Marc Bates, Criswell Chizengeya und Daniel Bates (von links nach rechts) 2 Abend noch mit Kapitän Criswell Chizengeya bekannt, dem Projektoffizier der Heilsarmee in Zimbabwe und unserem Begleiter für die nächsten Tage. Sein Lachen, mit dem er seine weissen Zähne aufblitzen lässt, zieht uns alle in den Bann. Und er lacht viel. Auf jeden Fall viel mehr, als man es angesichts seiner Sorgen und Schwierigkeiten von ihm erwarten könnte.
Mit Babymilchpulver gegen AIDS
Donnerstagmorgen, der zweite Tag. Wir irren durch einen Vorort von Harare und suchen die Connaught-Klinik von Prof. Dr. med. Ruedi Lüthy, dem ehemaligen AIDS-Spezialisten des Universitätsspitals Zürich. Niemand scheint die Klinik zu kennen. Kurz vor dem Aufgeben, erreichen wir Dr. Lüthy jedoch via Handy und finden den Weg doch noch. Zuerst bin ich etwas enttäuscht: Die Connaught-Klinik ist kein repräsentatives Gebäude in einem grosszügigen Park. Im Gegenteil, die Anlage besteht eigentlich nur aus zwei bis drei eingeschossigen, unscheinbaren Bungalows, versteckt hinter hohen Mauern. Dr. Lüthy betreibt dort eine ambulante AIDS-Station. Er behandelt nicht nur, er bildet auch aus. Krankenschwestern und einfache Leute, die er dann dorthin zurückschickt, wo sie herkommen: in die Slums, dort, wo vor allem Hunger und AIDS zuhause sind. Seine Devise: Gib AIDS gar nicht erst eine Chance, denn wenn das Virus einmal da ist, ist es meist schon zu spät. Sein Hauptproblem: fehlendes Babymilchpulver, denn das Virus wird bereits über die Muttermilch auf die Kinder übertragen. Seine Frustration: Das Schild am Eingang mit der Aufschrift Leider sind wir ausgebucht und können keine neuen Patienten mehr aufnehmen.
>>Newsletter als PDF herunterladen<<
Text: Samuel Büchi

Endlich in Afrika!
Wir sitzen wieder im Auto und verlassen Harare Richtung Victoria Falls auf einer der mehrspurigen Ausfallstrassen. In meinen Ohren klingen immer noch die Worte des Landesleiters von Zimbabwe und Botswana, Kommissär Stanslous Mutewera, nach, mit denen er uns begrüsst und auf die Reise geschickt hat: «Seid Botschafter eures Landes in unserem Land und kehrt danach als Botschafter unseres Landes in euer Land zurück!» Wir fahren an einem modernen Fussballstadion vorbei. Wieder taucht in mir die Frage auf: Ist dies das «arme» Afrika? Je weiter wir uns jedoch von Harare entfernen, desto enger und schlechter werden die Strassen. Die Hochhäuser werden von einfachen Zementhäusern und diese wiederum von runden strohbedeckten Hütten abgelöst. Am Strassenrand begegnen uns Menschen. Kinder, viele Kinder, und Frauen, die ihr Gepäck auf den Köpfen tragen. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Endlich sind wir in Afrika!
Der Armut auf der Spur
Ein Zwischenhalt in Kadoma, einer Kleinstadt auf dem Weg nach Vic-Falls. Wir betreten einen der zahlreichen Läden auf dem bevölkerten Hauptplatz, in der Hoffnung, dort eine Zwischenverpflegung zu erhalten. Zu kaufen gibt es dort aber nur Alkoholika, ein wenig trockenes Gemüse und Putzmittel. Alle andern Regale sind leer. Wir werden beobachtet, zwar nicht feindselig, aber auch nicht gerade freundlich. Ich stelle mir vor, was los wäre, wenn ich eine Kiste Mehl oder Mais aus meinem Ärmel zaubern könnte und damit die Regale füllen würde. Ich glaube, jetzt sind wir der Armut auf der Spur.
Atemberaubende Natur …
Freitagmorgen, der dritte Tag. Nach elf Stunden Fahrt über holprige Strassen, teilweise ohne festen Belag, zu sechst in einem Fünfplätzer und mit viel zu wenig Flüssigkeit (ein Fehler, den wir nachher nie mehr begehen), haben wir am Vorabend um elf Uhr nachts Vic-Falls im äussersten Westen Zimbabwes an der Grenze zu Zambia, Namibia und Botswana erreicht. An diese Strapazen denkt heute aber keiner mehr, denn vor uns präsentiert sich ein unglaubliches Naturschauspiel – die Victoria Fälle. Auf einer Breite von rund zwei Kilometern stürzt sich der Sambesi, einer der längsten Flüsse Afrikas, mit lautem Getöse in eine rund 110 Meter tiefe Schlucht und hinterlässt dabei eine riesige Nebelwolke. Dieses faszinierende Zusammenspiel von Wasser, Erde und Luft, erinnert mich einmal mehr an die Genialität, mit welcher Gott diese Erde schuf. Die lärmenden und stinkenden Lastwagen auf der Victoria Falls Bridge erinnern mich aber auch an die Leichtigkeit, mit der wir solche filigranen Gefüge aus den Fugen bringen.
Die Feste feiern wie sie fallen
Sonntagmorgen, der fünfte Tag. Im Heilsarmee-Korps von Nkulumane in einem Vorort von Bulawayo, der zweitgrössten Stadt Zimbabwes, erwartet man uns schon. So interpretiere ich wenigstens das mitreissende Spiel der etwa fünfzehn Musikanten bei unserem Eintreffen. Als Erstes fällt mir der Saal auf, ein Gebäude, etwas kleiner als das Zenti, mit Fenstern ohne Scheiben und mit einem Naturboden. Es hat nur sehr wenige Bänke, die meisten Leute sitzen auf dem Boden, trotz ihren herausgeputzten und teilweise sogar mit Bügelfalten versehenen weiss-beigen Uniformen. In einem krassen Gegensatz zur Schlichtheit des Gebäudes steht aber die Art und Weise, wie die Salutisten dort Gottesdienst feiern. Jawohl, feiern! Jeder, der etwas zum Gottesdienst beisteuert, tut dies, indem er an seinem Platz einen Chorus anstimmt, dann unter dem Jubel und Beifall der übrigen Leute nach vorne kommt und dort sein Zeugnis gibt, aus der Bibel liest oder sein Lied singt. Ist dann das Ganze fertig, geht er wieder an seinen Platz, wie er gekommen ist: singend, tanzend, klatschend. Der absolute Höhepunkt des Feierns findet aber zwischen den beiden Gottesdiensten statt. Etwa eine halbe Stunde vor Beginn der Heilsversammlung fängt irgendwo im Saal irgendjemand an, irgendeinen Chorus zu singen, dazu in die Hände zu klatschen oder irgendein Schlaginstrument zu schlagen und zu tanzen. Und irgendein Anderer stimmt mit ein und irgendein Dritter kommt dazu und irgendwie geht dies dann immer weiter, bis der ganze Saal am Singen und Tanzen und Jubeln ist – eine Riesen-Party. Das Ganze nimmt erst dann ein Ende, wenn der Offizier vorne hin steht, mit erhobenen Händen um Ruhe bittet und den Gottesdienst beginnt. Ich bin sicher, wenn ich den Offizier draussen ins WC-Häuschen gesperrt und nicht mehr frei gelassen hätte, die Party wäre am Abend noch in Gang gewesen.
Über Geld und Geduld
Montag, der sechste Tag. Gemäss Programm soll heute der Container im DHQ von Bulawayo ankommen. Wie gesagt, soll, tut es aber nicht. Irgendeines der in Afrika so eminent wichtigen Formulare hat offensichtlich einen der in Afrika mindestens ebenso wichtigen Stempel zu wenig und die Person, die befugt ist, diesen Stempel auf das Formular zu drücken, ist nicht auffindbar. Dies bedeutet – warten. Wir nutzen das Warten, um uns die Stadt anzusehen. Da ist zum Beispiel das ausgediente Korpsgebäude (als Saal zu klein), in welchem die Heilsarmee heute ein Internet-Café betreibt. Der Erlös wird zur Finanzierung eines anderen Projektes benutzt. Irgendwie erstaunlich. Auch mit sehr wenig Geld spielen offensichtlich Mobilität und Information eine sehr wichtige Rolle. Apropos Geld: Ich habe heute 20 Millionen Zim-Dollars bei mir, etwa 10 Schweizer Franken. Die grösste Note ist die 200’000-er. Ich habe also ein Bündel von mindestens 100 Banknoten in der Hand. Loswerden kann ich das Geld nur gerade in einem Souvenirshop oder bei den wenigen Händlern auf dem Markt. Es hat zwar auch ein Warenhaus und dort gibt es sogar Tanganda, zimbabwischen Tee. Ich möchte eine Schachtel kaufen, bekomme sie aber nicht. Grund: Am nächsten Tag schlägt der Preis auf und man verkauft lieber nichts, als mit Verlust. Freude pur: Worship-Party im Nkulumane Koprs 5 In der Wimpy-Bar, einem Fast- Food-Restaurant, essen wir Chicken and Chips, neben Beef-Chop (mehrheitlich Knochen) and Chips das einzige Menu. Für acht Personen kostet dies etwa 100 Millionen Zim-Dollars, rund 50 Franken. Criswell blättert daher etwa 700 Banknoten einzeln auf den Tisch. Die Kellnerin zählt es nach – ebenfalls einzeln. Na ja, auch so geht der Nachmittag vorüber. Apropos Zeit. Zeit ist in Zimbabwe nahezu identisch mit Geduld. Von beidem müssen die Leute enorm viel haben. Viele von ihnen verbringen sehr viel Zeit beim Anstehen. Anstehen vor einer Bank zum Beispiel oder vor einem Bancomaten. Wie wir später an einem konkreten Beispiel erfahren, muss man manchmal bis zu zehn Stunden anstehen. Wenn man Pech hat, geht man ohne Geld wieder weg, weil die Bank out of money ist. Doch auch wer Glück hat, kann sich nicht unbedingt glücklich schätzen, denn die maximale tägliche Bezugsrate ist bei 5 Millionen Zim-Dollars (rund 2.50 Franken). Ich glaube, nun bin ich der Armut schon wieder ein Stück näher gekommen.
Der Container ist da!
Dienstagnachmittag, der siebte Tag. Im DHQ kommt Hektik auf. Der Stempel ist offensichtlich auf dem Formular und der Container unterwegs zu uns! Dennoch dauert es einige Zeit, bis er tatsächlich hier ist. Doch dann ist er endlich da. Wir sind gespannt, ob wirklich noch alles drin ist, was wir vor zwei Monaten in Bern hinein gepackt haben. Die Türen werden geöffnet und – tatsächlich, alles scheint noch drin zu sein. Das Ausladen verläuft unheimlich schnell. Wie aus dem Hut gezaubert sind auch plötzlich viele Leute hier, die anpacken und mithelfen, Criswell und der DO allen voran. Alles wird fein säuberlich im Saal aufgeschichtet. Sogar die lose verpackten 300 Zivilschutzkombis liegen auf einem separaten Haufen. Keine zwei Stunden nach seiner Ankunft ist der leere Container bereits wieder weg. Aber was nun? Es ist bereits wieder Abend und die Dunkelheit bricht sehr schnell herein. Wir beschliessen, Criswell mit der Verteilung der Güter zu beauftragen und lassen uns zu unserer nächsten Station bringen, dem Masiye Camp, eine gute Autostunde ausserhalb von Bulawayo. Am nächsten Tag erfahren wir, dass die drei zuständigen Divisionsoffiziere die Schachteln unter sich für ihre Divisionen aufgeteilt haben. Nicht nach deren Inhalt, nein, nach den Farben der Schachteln. Toll! Na ja, in Afrika denkt man eben anders, farbiger vielleicht und nicht so tabellarisch wie wir.
Mutproben als Therapie
Mittwoch und Donnerstag, der achte und der neunte Tag. Masiye Camp, ein wunderschöner Bungalow-Park, mitten in einer phantastischen, bizarren Landschaft, direkt an den Matopo-Nationalpark grenzend. Masiye Camp, aber auch eine Institution, in welcher Jahr für Jahr Dutzende von Kindern 10 bis 14 unbeschwerte Tage verbringen können und dabei lernen, mit dem Trauma umzugehen, ihre Eltern oder Geschwister durch AIDS verloren zu haben. Leider findet zurzeit kein solches Camp statt und sind demnach keine Kinder da. Dafür hat man Zeit, mit uns zwei solche «Therapien» durchzuführen. Wir müssen zum Beispiel eine steile Felswand hochklettern, um uns danach mit dem Rücken voran wieder abseilen zu lassen. Oder wir gleiten mit einer Rolle auf einem gespannten Drahtseil (Tyrolienne) von einem Felsvorsprung über einen See in die Tiefe. Was das Ganze soll? Nun, wir haben am eigenen Leib miterlebt, was Überwindung oder Gruppendruck bedeutet. Das Gefühl, etwas geschafft zu haben, oder aber zu etwas Nein sagen zu können. Am Abend beim Nachtessen unter freiem Himmel und bei Kerzenlicht reden wir miteinander über die Erfahrungen mit diesen Mutproben. Und spätestens nachdem Kapitänin Kim Gilles, Australierin und Leiterin des Masiye Camps, uns Geschichten aus diesen Lagern erzählt, beginne ich zu begreifen, dass dort draussen, abseits der Zivilisation und inmitten der Wildnis, unzählige höchst traumatisierte Kinder ihre Seele zurückbekommen. Danke Kim. Danke für dieses Erlebnis.
Doctor Howse
Donnerstag, der neunte Tag. Zugegeben, zuerst war es wohl eher die Ähnlichkeit ihres Namens, Doctor Howse, mit dem Held der TV-Serie Doctor House, welche mich auf die Idee brachte. Einen Moment lang habe ich daran gedacht, dass man mit der medizinischen Leiterin des Tshelanyemba Hospitals, der Kanadierin Doctor Dawn Howse, tatsächlich eine TV-Serie machen sollte. Es wirkt beinahe kitschig: Sie ist hochqualifizierte Medizinerin, Juniormusikleiterin, Schwimmlehrerin, Sonntagschullehrerin, Vorsängerin in den Gottesdiensten und noch vieles mehr. Aber es ist kein Kitsch, es ist Sinnbild für die Einstellung dieser kleinen, aber dennoch grossartigen Frau. Und ihr nach über zwanzig Jahren Dienst in Afrika noch kaum gebrochener Enthusiasmus scheint auf das gesamte Personal überzuschwappen. Man zeigt uns das Spital, stolz und ohne zu jammern, stets mit einem freundlichen Lächeln im Gesicht. Dabei hätte man allen Grund zum Heulen. Kurz vor sechs Uhr abends, fast pünktlich zum Nachtessen, fällt der Strom aus. «Ach, kein Problem», gibt man uns zu verstehen, «so um zehn Uhr wird der Strom wieder da sein. Das ist beinahe jeden Tag so.» Ich glaube, nicht richtig zu hören. Ein Spital, bei dem jeden Tag für mehr als vier Stunden der Strom ausfällt? Undenkbar – in Europa vielleicht, in Tshelanyemba aber nimmt man so etwas mit einem Lächeln hin.
Der lachende Kenianer
Freitagmorgen, der zehnte Tag. Wir warten wieder einmal. Diesmal aber nicht auf einen Container, der ist schon seit Wochen hier. Nein, heute warten wir auf Oberst Peter Dali, den Chefsekretär. Aber auch diese zweistündige Verspätung nimmt man gelassen hier in Tshelanyemba. «Hier zu uns hinaus kommt nie jemand pünktlich.» So oder ähnlich tönt es vom Personal.
Aber schliesslich ist auch er da, der lachende Kenianer – ich habe noch nie einen Mann gesehen, der so herzhaft lachen kann – und der Einweihungsmarathon kann beginnen. Zuerst wird eine Bewässerungsanlage für ein Gemüsefeld ihrer Bestimmung übergeben, dann unser Container geöffnet und zum Schluss noch ein Personalhaus, das Canadian House, eingeweiht.
Wir verlassen Tshelanyemba nach dem Mittagessen. Uns steht eine rund zehnstündige Autofahrt zurück nach Harare bevor. Ich stelle mir eine relativ lockere Reise vor, denn zum grössten Teil sind wir ja auf der Hauptverbindungsstrasse zwischen Bulawayo und Harare, den beiden grössten Städten des Landes unterwegs. Es kommt aber wieder einmal ganz anders. Ich sitze die meiste Zeit wie auf Nadeln. Die Strecke muss zum grössten Teil bei Dunkelheit zurückgelegt werden und die Strassen haben keine Beleuchtung, nicht einmal in den Städten, denn es ist ja wieder einmal die Zeit des Stromausfalls.
Nicht ungefährlich ist es auch wegen der vielen Tiere, die sich immer wieder auf die Strasse verirren. Aber trotzdem: mit Harare erreichen wir nach rund 3’000 Kilometern Fahrt wieder unseren Ausgangspunkt, ohne nennenswerten Zwischenfall, nicht zuletzt auch dank unserem hervorragenden Fahrer, Criswell Chizengeya. Thank you captain, you’re a great guy!
Noch am gleichen Abend müssen wir uns von unserem Freund Thomas Kagoro verabschieden. Er ist dunkelhäutig, wurde in Zimbabwe geboren und war während der Zeit, als Daniel Bates in Harare lebte, dessen bester Freund. Während seine Eltern und Geschwister immer noch in Zimbabwe sind, lebt Thomas aber seit einigen Jahren in den USA. Er hat die ganze Reise mitgemacht und ist uns allen ans Herz gewachsen. Ich werde mich noch lange an ihn erinnern, den grössten Spassvogel, der aber schon Minuten später wieder todernst sein konnte. Seine Kenntnisse über Land, Leute und Sprache haben uns viel geholfen. Thank you Tom, you’re a great guy too!
Good Bye Africa
Sonntagnachmittag, zwölfter Tag. Einmal mehr warten wir. Diesmal auf dem Flughafen von Harare. Kurz nach Mittag bringt uns Criswell zum Flughafen und verabschiedet sich von uns. Einmal mehr beginnt das grosse Warten. Ich weiss nicht, ob und wann Criswell mitbekommen hat, dass wir 24 Stunden später immer noch in Zimbabwe sind. Ein Flugzeugdefekt und/oder andere Probleme führen dazu, dass wir erst einen Tag später als vorgesehen abfliegen können und über 30 Stunden zu spät zu Hause ankommen. Irgendwann auf irgendeiner unbequemen Bank im Flughafen von Harare bekomme ich langsam den Koller. Ich wünsche mir nichts Sehnlicheres, als dass dieser ver… Flieger hier endlich auftaucht! Doch bereits während des langen Fluges von Johannesburg nach Paris denke ich wieder anders und erwische mich dabei, bereits neue Pläne zu schmieden. Pläne, in denen es natürlich um Zimbabwe geht. Ich bin ausgezogen, um den Menschen in Zimbabwe etwas von meinem Reichtum abzugeben, habe im Gegenzug aber viel, viel mehr von ihrem Reichtum abbekommen. So viel, dass ich ihnen unbedingt wieder einmal von meinem Reichtum abgeben möchte. Und – ich gebe es ja zu – sei es nur darum, dass ich mich erneut von ihrem Reichtum beschenken lassen kann.
>>Newsletter als PDF herunterladen<<
Text: Samuel Büchi